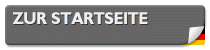Geschichten
Aus der Unterwelt

alte Postkarte (Altane u. Uhrenturm)
(von Chr. Fleischhauer) [Landauf, landab – Geschichte und Geschichten aus dem Waldecker Land, Verlag Ernst Funk, Bad Wildungen 1924]
Der Einjährige Millner war zum ersten Male mit dem Kommando von 40 Mann nach Schloß Waldeck gekommen. Er hatte gerade nicht sehr gern den Aufenthalt in der Residenz (Schloß Arolsen) mit dem in dem alten „Steinkasten“ (Burg Waldeck) vertauscht. Das Romantische der alten Burg reizte ihn gar nicht, wie er schon unterwegs dem Kommandoführer widerholt auseinandergesetzt. Aber was half das Räsonieren? Der Bien muß!
Der Einjährige war bei den Kameraden nicht beliebt. „Ein Hochmutspinkel ist er!“ sagte der Frieder aus dem Edertale, der auch mit dem Kommando war. „Ein ausgemachter Hochmutspinkel, das sag ich!“
Der Frieder ging, im Gegensatz zum Einjährigen, gar gern mit zum alten Schlosse. Er kannte es seit seiner Jugendzeit und war während seiner Dienstzeit mehr als einmal hier oben auf Kommando gewesen. Und er ging immer wieder gern mit, drängte sich dazu, denn er wußte wohl Gelegenheit zu finden, im Laufe des Monats mehr als einmal nächtlicherweise den alten Mauern den Rücken zu kehren und drunten im Heimatdorfe einen Tanz oder eine Spinnstube mitzumachen. Doch ich will nichts weiter verraten, wenn auch unser Frieder schon längst auf Kommando bei der großen Armee ist.
Frieders Ärger auf den Einjährigen hatte einen besonderen Grund. Er wäre seinerzeit gern bei ihm Bursche geworden, der Extra-Einnahme wegen. Aber Millner hatte den Frieder einen Tölpel genannt. Aus seiner Anstellung war nichts geworden, aber der Ärger war geblieben. Rache ist süß. Vielleicht, daß sich hier oben, wo Frieder alle Winkel kannte, einmal Gelegenheit bot, dem „Hochmutspinsel“ eins auszuwischen.
Und die Gelegenheit kam.
Wer das alte Schloß kennt, weiß, daß sich im Erdgeschoß des Hauptflügels, nahe dem Tore, die Wachstube befand und daß sich unter diesem Erdgeschoß ein weiter Kellerraum hinzieht, so groß, daß man drinnen ein Volksfest feiern könnte. Heute (um das Jahr 1920) lagern dort die geistreichen, teueren Vorräte des Schloßwirts. Damals befanden sich hier unten die Marmorsägereien, in denen eine Reihe Zuchthäusler beschäftigt war. Es war ein mühselig Geschäft, den harten Stein zu sägen. Zwei Männer bedienten die Handsäge in stetem Hin und Her. Ein dritter stand dabei und kühlte den heißgelaufenen Stahl mit Wasser. Und das Wasser? Ein rarer Artikel hier oben. Da war in dem nahe dem Schloßeingange gelegenen Teile dieses Stückes Unterwelt eine weite Grube ausgehoben. Hier sammelten sich die Abwässer des Schloßhofes: Regenwasser, Jauche und andere angenehme Flüssigkeiten und bildeten einen Kump. Durch einen Schacht, den nahe dem Schloßtor ein eiserner Rost deckt, floß das Wasser in die Tiefe und gab dem Handlanger den Stoff zum Netzen der Säge.
Ein guter Kletterer konnte leicht aus der Unterwelt an den Eisenrost gelangen und einen Blick hinaus tun in die enge Welt des Schloßhofes – bei trockenem Wetter! Sonst –
Heute Nacht stand der Einjährige Posten im Tonnengewölbe des Schloßtores. Bis 12 Uhr mußte er hier gehen und stehen. Je nachdem. Und dann, wenn es heute Nacht 12 Uhr schlug, ging ein neues Jahr an. Neujahr! Und das erleben in dem alten Steinkasten! Langweilig, zum Sauerwerden langweilig. Noch Minuten, dann werden in der Residenz die Gläser klirren, die Toaste ertönen. Hier schreien die Eulen, schnarchen die Gefangenen, sitzt die Wachmannschaft bei qualmender Ölfunzel bei Kartenspiel und Dünnbier im rauchigen Lokale. Langweilig – entsetzlich lang - -
Millner fuhr aus seinen Gedanken jäh empor und sprang zur Seite. Er stand, ohne daß er es wußte, dicht neben dem Eisenroste der den Schacht in die Unterwelt deckte.
Millner horchte. Was war das? War nicht eben sein Name gerufen worden? M –M – i – ll – ner. Klar und deutlich. Woher kam die Stimme. Jetzt wieder. Spukte es hier wirklich, wie alle Abend in der Wachstube erzählt wurde? Die Haare wuchsen unter dem Helme. Da – kams wieder. Eine hohle Stimme. Nicht rechts, nicht von links, nicht von oben! Ohne Zweifel. Aus der Tiefe der Erde.
Da hob die Uhr aus zum Sachlage. Zwölf! Und da kam’s deutlich von unten: „Prost Neujahr! Millner, Sie sind ein Tölpel, ein - - „
Noch ein Lachen, und dann ein Krachen, ein Rutschen, ein Schrei, ein Platsch, wie wenn ein Stein ins Wasser fällt, ein unterdrückter Hilferuf - - -.
Neujahrsläuten vom Turme der Stadtkirche! Schüsse! Glückwünsche! Ablösung!
Mehr tot als lebendig stürzte der Einjährige in die Wachstube. Kreidebleich stand er und erzählte sein Erlebnis, dann sank er in den Sessel des Kommandoführers und stöhnte: „Einen Schnaps, gebt mir einen Schnaps!“
Ungläubig starrte man den armen Millner an. Zum Glück trat eben der Gefangenenwärter, der in jener Zeit zugleich Schloßwirt war, mit einer Ladung Dünnbier und Branntwein in die Erscheinung. Man wollte doch hier auch Neujahr feiern.
Der Alte hatte sofort ahnend die Lage erfaßt. Sein Schlüsselbund rasselte, seine Ölfunzel leuchtete, und mit ein paar beherzten Soldaten gings die lange, lange Treppe vom Schloßhofe hinab in die Tiefe des Kellergeschosses. Ein seltsam Bild bei trübem Lampenscheine. In dem weiten Tümpel da unten schwamm und schnatterte die Edergans, schnatterte vor Frost und konnte das Ufer nicht finden.
Man zog den Duftenden heraus. Er erzählte zähneklappernd, wie er, den Einjährigen zu schrecken, bis zu dem Eisenrost vorgedrungen sei, wie er gerufen, sich dann aber vor Lachen nicht mehr habe halten können. Das Weitere lag vor aller Augen und beschäftigte alle Nasen.
„Bestrafter Vorwitz!“ knurrte der Gefangenenwärter und machte dazu eine bezeichnende Bewegung mit der Hand. Er hätte gern der Strafe noch einigen Nachdruck mit der Haselnußgerte gegeben. Das war sonst sein Amt.
In der Nacht bezog Frieder keine Wache mehr. Seine Kluft mußte ausgelüftet, ausgewaschen und getrocknet werden. Er selbst lag, in Decken gewickelt, auf der Pritsche, frierend.
„Leg noch ein Knickstchen in den Ofen!“ stöhnte er. Ein „Fäßchen“ hatte der Einjährige für die Neujahrsfeier schon vorher bewilligt. Nun aber!
„Dünnbier für einen Halbtoten!“ fragte vorwurfsvoll der Sergeant. Millner verstand. Hätte er nicht verstanden, das Licht wäre ihm gekommen, da ein Soldat dem anderen in die Rippen stieß und laut genug bemerkte: „Punsch wäre besser als Bier, auch für uns!“
Auf einen Wink des Einjährigen eilte der Kantinenwirt geschäftig hinaus. Bald kochte auf dem kleinen Ofen das Wasser im mächtigen Kessel, bald dampfte der Punsch. Es kam Leben in die Bude und auch Frieder taute auf. Der Einjährige war gar nicht so. Nach dem fünften Glase machte sich in ihm eine Stimme bemerkbar, die ihm sagte, daß er eigentlich an dem Unglücke schuld sei. Beim sechten Glase setzte er sich neben den Unglücksraben, beim siebenten fing er an, ihn zu trösten, beim achten sprach er feierlich:“Wenn wir sieder glücklich nach Arolsen kommen, sollst du mein Bursche werden.“ Da drückte der Frieder, hingerissen von Dankbarkeit und Punsch, dem Gütigen die Hand, daß die Finger knackten und sagte gerührt: „Und ich gehe für dich durch dick und dünn, darauf kannst du dich verlassen!“
Dann wischte er sich die Stirn und streckte die große Zehe unter der Decke hervor.
Er war ins Schwitzen gekommen.
Die Stollmühle (Eine Volksüberlieferung)

Foto: Moritz Bötcher
[Abgedruckt in "Volksüberlieferungen aus dem Fürstenthum Waldeck", Autor: Ludwig Curtze, Verlag A. Speyer, Arolsen 1860)
Der Fürst Anton Ulrich reiste einmal von Arolsen nach Fritzlar. Bei seiner Zurückkehr war die Eder so groß geworden, dass er sich fürchtete, hindurch zu reiten. Da erbot sich ein junger Müllerbursch aus Fritzlar, vor ihm her zu reiten. Dadurch bewogen, sagte der Fürst zu ihm: "Mein Sohn, hast du Lust später einmal in meinem Lande eine Mühle zu pachten, so wende dich an mich". Der junge Mensch kam nun und pachtete die Mühle zu Gellershausen. Als aber später diese Mühle ohne sein Wissen an einen Anderen verpachtet worden war, so machte er sich gleich auf nach Arolsen. Auf seinem Wege dorthin kam er an einem Platz, wo zwei Arrestanten, welche auf dem Schlosse Waldeck gesessen hatten, wegen eines Hammerwerkes einen ungefähr 100 Fuß langen und 10 Fuß hohen Stollen durch den Berg gehauen hatten, wofür ihnen ihre Freiheit geschenkt war. Dieser Platz gefiel ihm so gut, dass er in Arolsen nun den Fürsten bat, ihm diesen Platz schenken zu wollen. Der Fürst schenkte ihm denselben und nun erbaute er hier die Mühle, welche jetzt noch daselbst steht und den Namen "Stollmühle" trägt.
(Heute gibt es diese Mühle schon lange nicht mehr. Denn seit fast 100 Jahren liegen ihre Grundmauern auf dem Grund des Edersees)
Das Foto wurde von Frau Ilse Severin zur Verfügung gestellt.
von Christian Fleischhauer aus dem Buch "Landauf, landab!"
Ich möchte hier die im Buch „ Landauf, landab“ abgedruckte Geschichte nicht Wort für Wort wiedergeben, sondern die, wie wir es in Neudeutsch ausdrücken, zugrunde liegende Message wiedergeben.
Vor hundert Jahren - Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts – wanderten viele europäische Bürger nach Amerika aus, in der Hoffnung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein Auskommen und das Glück zu finden. Und viele von Ihnen schafften es in der Tat auch, dass es ihnen im fernen Amerika besser ging als zuvor hier in Europa.
So reiste auch eine junge Familie aus dem Waldecker Land zusammen mit der Mutter nach Amerika aus. Sie fand in Chicago ein neues Zuhause und Arbeit. Es ging ihnen gut. Die jungen Leute konnten sich in der neuen Heimat gut zurecht finden und lernten sich in der dortigen Umgangssprache auszudrücken. Ihren Kindern fiel dies noch wesentlich leichter, da sie dort mit der englischen Sprache aufwuchsen. Schwerer hingegen fiel es der Großmutter sich mit der Sprache und der neuen Heimat anzufreunden. Sie lernte nur einige wenige englische Worte (Brocken) und sprach im Familienkreis in ihrer Heimatsprache. Kurzum sie sprach deutsch, dachte in Deutsch und sehnte sich nach ihrer alten und einzigen Heimat.
Die Kinder der Familie wuchsen in der Obhut der Großmutter auf und so lernten sie neben der englischen Sprache auch die deutsche Sprache kennen. Sie waren letztlich in der deutschen Sprache ebenso sicher wie in der englischen. Aber sie lernten durch ihre Großmutter nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur, die Sitten, die Poesie, Geschichten, Märchen und Sagen aus der alten Heimat kennen.
In stiller Dämmerstunde saß die Großmutter in ihrem weichen Sessel und um sie herum hockten die Enkelkinder. Ganz wie es früher hier in der waldeckischen Heimat Sitte war. Während die alte Frau behände strickte, erzählte sie den Kindern die alten Märchen und Sagen aus ihrer Heimat, die sie selbst als Kind gehört hatte und die Enkel hörten gespannt und aufmerksam zu. Nicht genug konnten sie von diesen Geschichten hören und bedrängen die Frau immer wieder aufs Neue Geschichten zu erzählen. Ganz, wie es die Großmutter von daheim her kannte.
Und nicht nur die Kinder hörten der alten Frau gespannt zu, auch die Schwiegertochter hielt ab und zu inne und lauschte der Worte, die ihr auch noch aus ihren Kindertagen wohl bekannt waren und die in ihren Gedanken die alte Heimat mit Bildern aus dieser Zeit wieder in Erinnerung brachten. Wird auch sie einmal ihren Enkeln diese Geschichten erzählen, wie es ihre Schwiegermutter tut?
Auch uns Kindern hat meine Mutter und meine Oma Geschichten, Märchen und Sagen erzählt. Wir saßen dabei in der Küche oder im Wohnzimmer und lauschten gespannt den Worten. Später haben meine Frau und ich diese überlieferten Geschichten und Märchen unseren Kindern erzählt. Auch diese haben aufmerksam und gebannt den Worten gelauscht und immer wieder wollten sie mehr davon hören. Wenn wir heute auf diese Stunden zu sprechen kommen, leuchten ihre Augen wieder auf und sie erinnern sich nicht nur an die alten Märchen, sondern verknüpfen dies mit Bildern und Empfindungen aus der Kindheit. Ich bin mir gewiss, dass auch meine Kinder ihren Kindern die Märchen wieder erzählen und meine Enkel ebenso gespannt und interessiert den Worten lauschen werden.
Die Faszination Märchen ist heute genau noch so wie vor hundert Jahren und davor.
Heimkehr
Eine wahre Weihnachts-Erzählung von Chr. Fleischhauer, aus dem Buch "Landauf, landab!", erschienen im Ernst Funk Nachf. Verlag, Bad Wildungen 1924
Das alte strohbedeckte Häuschen lag etwas abseits vom Wege. Hilfsbedürftig lehnte es mit seiner hinteren Seite an die Höhe, die die Berge unseres Uplandes aussenden als Übergang in das flache Land.
Alt und morsch, wie das Haus da am Wege, waren seine beiden Bewohner, der Hanjost Reider und seine Ehefrau Annemarie. Die beiden Leutchen fristeten ihr Leben von den kleinen Ersparnisses des Mannes aus seiner Bergmannszeit, vom Ertrage des kleinen Ackers hinter dem Hause und aus den geringen Zuwendungen seitens der beiden Töchter, die im "Bergischen" verheiratet waren und auch nicht im Überflusse schwammen, wenn es ihnen auch gerade nicht schlecht ging. Und der Sohn, auf den sie in früheren Jahren so große Hoffnungen gesetzt? Ja, der war ausgewandert über's Meer, hatte das Glück gesucht, aber wohl nicht gefunden. Er war ja schon lange tot. Die Nachricht von seinem Ende lag dort in der wurmstichigen Kommode.
Nach sonnigen Herbsttagen war der Vorwinter gekommen, der November mit seinem bleischweren, grauen Himmel, der aussah, als wollte er täglich gewaltige Schneemassen ausschütten über die zur Winterruhe gehende Welt. Dort oben auf dem Dommel hatte die erste Schneehaube schon gelegen. Für hier unten war es noch etwas früh. Doch auch im Tale fielen die letzten Blätter, die letzten Blumen im Gärtchen des altersschwachen Häuschens neigten die Köpfe, vom Froste geknickt. Der Winter kam.
Die alten Leutchen kümmerte das nicht. Bei ihnen war es schon lange Winter, draußen und drinnen.
Der Sturm rüttelte am Dache, daß die Moospolster herabkollerten, raste durch den Garten, fegt über die Höhen; die Wolken flogen, düster, regenschwer.
"Der wilde Jäger" sagte Hannes wichtig zu seiner Hausehre. Er kannte die Sagen der Heimat und erzählte gern von ihnen den lauschenden Kleinen, die oft vor seiner Tür saßen, und den Alten, mit denen er ab und zu unter der Dorflinde saß.
"Der wilde Jäger! Halt, Häuschen, halt aus, so lange wir noch da sind, das Annemarichen und ich. - Wenn -- dann - ja -." Mit Mühe schloß er die morsche Tür des Stalles, in dem Ziege und Schweinchen hausten und band mit einer Weidenrute die kleine Lattentür am Hausgärtchen fester. Dann trat er in Haus, schob einen knorrigen Wurzelstock in den Kachelofen, der noch nach Sitte der guten alten Zeit von der Küche aus bedient wurde und trat in die Kleine sauber gehaltene Wohnstube.
"Was ein Wetter," knurrte der kleine, zusammengetrocknete Mann und hielt die steifen Hände an den tönernen Oberbau des Ofens.
"Schlimm für den, der da draußen wandern muß," seufzte die Frau und rückte das Spinnrad näher zum Tische.
"Das ist freilich nichts genaues, besonders nicht in unseren Bergen, wenn der wilde Jäger daherbraust und einem auch noch den Weg verlegt," meinte der Alte und entzündete mit einem Kienspan die kleine Sparöllampe, die den kleinen Raum nur notdürftig zu erhellen vermochte. Dann setzte er sich in den bequemen Lehnstuhl in der Ecke des Ofens, setzte die kleine Tonpfeife in Brand und sah dem Mütterchen zu, wie es mit fleißiger Hand den Faden zupfte und mit flinken Füßen das Rad bewegte. Tiefe Stille, außer dem Schnurren des Rades. Ein Engel ging durh die Stube.
"Konntest eigentlich mal wieder was vorlesen, Hanjost, die Abende sind so lang schon - -"
"Ja, Mutter, aber was? Aus dem Gesangbuch einen Psalm?"
"Warte einmal, Vater, krieg doch mal die "Spinnstube" vom Kammbrett, weißt du, die schönen Geschichten, die der Hansjakob - -"
"Aber die habe ich schon so viel mal gelesen."
"Das schadet nichts, die sind immer schön."
"Dann zu. Aber ich will doch die Tage mal zum Lehrer gehen, der hat vielleicht etwas für uns, Alte."
Damit zog er einen Stuhl zur Wand unter dem Kammbrette. Eben hatte er den Fuß gehoben, um hinaufzusteigen, da hielt er aufhorchend still.
"Da kommt noch jemand," sagte er verwundert. "Hörst Du nichts, Mutter, wer mag das sein?"
Das Spinnrad stand still.
"Hast recht, Vater, es sind ihrer zwei. Horch, der eine geht wieder fort, der andere kommt ins Haus."
"Muß ein Fremder sein, der sich den Weg hat zeigen lassen. Da bin ich aber neugierig."
Er öffnete zuvorkommend die Stubentür. Der matte Lichtschein der trüben Lampe fiel auf den dunklen Hausflur.
"Bin ich hier recht bei Herrn Hanjost Reider und seiner Frau Annemarie?" fragte eine tiefe Männerstimme aus dem Hintergunde.
"Wohl," antwortete Hanjost und riß die Tür auf, so weit es eben ging. "Wollen Sie nicht näher treten, Herr?"
"Ja, wenn Ihr mir ein wenig leuchten wollt, ich möchte Hals und Beine nicht gern brechen."
"Bring die Lampe, Mutter!"
"So, danke, jetzt gehts besser, gerade kein Prachtbau das!"
Und dann schob sich durch die niedere Tür eine hohe, breitschulterige Gestalt mit großem, einig gepflegtem Bart unter Hals und Kinn, wie ihn die Amerikaner zu tragen pflegen.
"Guten abend auch!
"Willkommen!" sagten die beiden Alten etwas gepreßt und drückten sich rückwärts an den Kachelofen.
"Einen Stuhl!" flüstere Hanjost seiner Frau zu und stieß sie etwas unsanft in die Seite. Annemarie ermannte sich, schoß flink auf den Stuhl zu, den ihr Mann eben hatte erklettern wollen, fegte den Sitz mit der Schürze ab und schob ihn dem Gaste hin.
"Well!" sagte der Fremde und warf sich auf das Gestühl, das in allen Fugen krachte, spuckte einmal mit Macht in die Stube, räusperte sich und begann:
"Ihr kennt mich wohl nicht?!"
Die beiden Alten starrten mit offenem Munde den seltsamen Gast an und schwiegen auf seine Frage. Schweigen ist auch eine Antwort.
"Well!" Ist auch nicht gut möglich. Ich stamme aus Warburg da drüben, bin aber jetzt in Amerika daheim, schon lange und nur auf kurze Zeit zu Besuch in der Heimat. Drüben habe ich Euren Sohn getroffen und ihm versprochen Euch zu besuchen und einen Gruß auszurichten."
Die Alten standen sprachlos, versteinert.
"Na, scheint, Ihr freut Euch nicht mal, etwas von dem Johannes zu hören!" knurrte der Amerikaner befremdet.
Da schlug Annemarie die Hände über dem Kopf zusammen.
"Das ist doch nicht möglich, Herr!"
"Was ist nicht möglich?" polterte der Fremde.
"Daß Ihr uns von dem Johannes grüßen sollt," mischte sich Hanjost jetzt ins Gespräch.
"Nicht möglich? Aber warum denn nicht, nehmt mir nicht über, aber das versteh einer!"
"Der Johannes ist ja tot!" jammerte die Frau.
„Da soll doch!“ fuhr der Amerikaner auf und ließ die Faust schwer auf den Tisch fallen. „ Da soll doch! Tot, sagt Ihr? Tot? Seit wann denn?“
„Seit neun Jahren schon,“ stammelte die Frau und fuhr mit dem Schürzenzipfel über die Augen.
Und Hanjost war an die Schublade am Tisch geeilt, hatte sie aufgeschlossen und mit zittrigen Händen zwischen alten Papieren gesucht. Ein gelbes, vergriffenes Blatt holte er hervor und hielte es dem Fremden hin. Der hielt das Papier nah an die Lampe und las. Je weiter er die Schrift entzifferte, desto mehr Erstaunen malte sich auf seinen Zügen. Jetzt ließ er das Blatt sinken und schaute starr die beiden Alten an, die erwartungsvoll vor ihm standen und in seinen Mienen zu lesen suchten.
„Sonderbar!“ sagte der Fremde und schüttelte den Kopf. „Sonderbar. Ein Totenschein aus dem Hospitale zu Saratoga Springo, Newyork, lautend auf einen Johannes Reider aus Deutschland. Sonderbar, höchst sonderbar. Euer Sohn heißt do Johannes?“
„Gewiß, es stimmt, wie es da steht!“
Der Amerikaner war aufgesprungen. Aufgeregt ging er durch die Stube, trommelte hastig an den beiden Fensterscheiben und warf sich endlich wieder wuchtig auf den Stuhl.
„Unsinn!“ rief er dann wütend. „Unsinn! Der Kuckuck mag daraus klug werden. Ich weiß doch, was ich weiß. Ich kenn doch Euren Sohn, den Johannes Reider“ Well! hab manchen Trunk mit ihm getan! Und von Euch hat er mir erzählt, und der Gegend hier. Well! Und vor einem Vierteljahr war er noch so wohl und munter wie wir drei, und dies hat er mir für Euch mitgegeben. Ha! Kann das auch einer, der seit neun Jahren tot ist? He, sagt?!“
Damit hatte der Aufgeregt in die Tasche geriffen und dem alten Hanjost ein Päckchen mit etwas Hartem in die Hand gedrückt.
Die alten Leutchen hatten sich an den Händen gefaßt. Sie vermochten vor innerer Bewegung kein Wort zu sprechen. Ihr Sohn sollte leben, lebte wirklich? Aufgeregt ging der Fremde noch immer in dem engen Raum auf und ab. Dann reichte er den alten Leuten die Hand zum Abschiede.
„Ich muß fort,“ sagte er, „mein Wagen wartet vor dem Wirtshause im Dorfe. Ihr werdet aber wieder von mir hören. Die Sache muß sich aufklären. Well, muß! Gebt den Wisch da einemal her. Werde ihn dem Johannes schicken. Ein guter Gedanke. Well! Und nun lebt wohl!“
Mutter Annemarie erinnerte sich ihrer Hausfrauenpflichten. Sie bot dem Fremden eine Erfrischung an. Er lehnte ab und Hanjost begleitete ihn bis zur Gartentüre.
Noch lange brannte an diesem Abende die trübe Sparöllampe im Stübchen des alten Ehepaares. Immer wieder sprachen sie von dem Fremden, von ihrem Johannes, von der merkwürdigen Nachricht, daß ihr Sohn vor einem Vierteljahr noch munter und gesund gewesen. Die „Spinnstube“ blieb auf dem Kammbrette liegen, dafür holte Hanjost die Bibel herbei und schlug sie auf.
„Lies den 23. Psalm!“ bat Annemarie.
„Ja!“ sagte der Alte einfach und setzte die Brille auf.
Und als das Licht erloschen war und die müden Augenlider der beiden Alten endlich, endlich der Schlaf küßte, betete die Mutter plötzlich laut: „Her Gott, laß uns den Johannes doch noch einmal sehen!“
„Amen!“ hatte Hanjost wie im Traum gesagt. Dann war es still geworden in dem Häuschen, das solche Aufregung seit Jahren nicht gesehen hatte.
„Ich habe geträumt,“ sagte am anderen Morgen Hanjost, „der Hannes war wirklich wieder hier - -„
„- und saß bei uns hier in der Stube, heil und gesund, so habe ich auch geträumt,“ setzte Annemarie hinzu.
Dann ging das Leben im Häuschen am Berge seinen altgewohnten Gang, den ganzen Winter hindurch.
„Die Sache muß sich aufklären,“ hatte der Amerikaner gesagt. Und die Aufklärung kam. Vom Dommel dort oben war die letzte Schneehaube geschwunden, dem lachenden Frühling zum Opfer gefallen. Die Osterglocken läuteten. Da klopfte Mr. John Werner aus Warburg an der Diemel wiederum an die Tür des altersschwachen Häusleins und saß wieder breitspurig auf dem altersschwachen Stuhle. Vor ihm standen die beiden Alten, gebeugter und runzliger als damals. Zwei Briefe hatte der Gast in der Hand. Der eine war an ihn selbst gerichtet, und die Einlage an Hanjost Reider und seine Ehefrau Annemarie. Der Amerikaner erzählte eine seltsame und doch wahre Geschichte, die sein Freund Johannes ihm mitgeteilt, nachdem er mit dem Totenschein in der Hand im Hospital zu Saratoga Springs im Staate Newyork die nötigen Nachforschungen angestellt hatte.
Dort im Krankenhause hatte er allerdings vor neun Jahren schwer krank gelegen, war auber gesundet, und wohl und munter hatte er das Hospital verlassen können. Aber ein anderer Kranker, der neben ihm an Fieber gelitten, war damals gestorben. Wie es nun geschehen, das war leider nicht mehr zu ermitteln gewesen, aber so viel war sicher, die Nummern, die zu Häuptern der Kranken angebracht gewesen, waren verwechselt worden. Und so war es gekommen, daß man in die Heimat eines Gesundeten die Besheinigung seines Todes gesandt hatte.
„Well!“ schloß der Fremde seinen Bericht. „So liegt die Sache, merkwürdig und doch einfach. Sie mußte sich aufklären. Aber das muß ich sagen, schön war es nicht von dem Johannes, daß er all die Zeit nichts von sich hat hören lassen. Hab’s ihm unter die Nase gerieben. Will’s wieder gut machen, schreibt er mir. Kommt im Laufe des Jahres selber heraus. Doch das wird er Euch genauer in dem Briefe da selbst schreiben.“
Noch eine lange Weile blieb diesmal Mr. John bei dem Elternpaar seines Freundes. Auch verschmähter diesmal nicht, ein Täßchen Kaffee mit den beiden Alten zu trinken. Er hatte sie liebgewonnen, und sie schauten zu ihm empor, wie zu einem höheren Wesen. Sie waren ja so einfache Leute.
* * *
Dann war Mr. John wieder über das Weltmeer gereist und nach einem heißen Sommer war ein rechter Uplandwinter gekommen, kernfest und auf die Dauer. Das Häuschen am Bergeshange lag tief im Schnee vergraben. Aber die weiße Decke in dem Vorgarten war jeden Morgen fortgekehrt und Bahn gemacht bis zur Straße, die zum nahen Dorfe führte, auf der Wagen und Schlitten sich selbst Bahn schaffen mußten.
Im Häuschen selbst war manches anders geworden, freundlicher, lichter, Johannes hatte reichliche Mittel gesandt. Man hatte die notwendigsten Ausbesserungen vornehmen können und auch ein Stübchen im Giebel herrichten können für einen lieben Gast.
Die trübe Sparöllampe war festlich geputzt und leuchtete ordentlich heller als im Vorjahre. Ihr Schein, der durch das Fenster über den Schnee da draußen glitt, konnte leicht Wegweiser sein für einen , der das Häuschen suchte.
Drinnen wartete man auf diesen Einen. Lange schon. Das ganze Jahr hindurch. Und heute war Weihnachtsabend. Wenn der Ersehnte wieder nicht kam in diesem Winter. – Weiß wie der Schnee dort draußen war das Haar der beiden Alten. Gebeugt vom Alter gingen sie ihrer Beschäftigung nach. Ja, wenn er nicht bald kam, der Johannes, vielleicht, daß er dann in ein leeres Häuslein kam und die Eltern ein noch kleiners bezogen hatten, in dem er sie nimmer besuchen konnte. –
Heute war Weihnachtsabend. Der Schnee knirschte unter den Füßen der Wandersleute und pfiff unter den Rädern der Fuhrwerke. Ein rechtes Weihnachtswetter!
„Willst Du nicht in die Christmette gehen, Hanjost?“ fragte die Mutter.
„Wir gingen früher immer zusammen, willst Du den nicht mit?“ war die Gegenfrage.
„Diesmal nicht, Vater. Der Johannes könnte kommen, und dann käme er vor ein verschossenes Haus und in eine kalte Stube.“
Der Alte lächelte trübe. Seine Hoffnung war gering, man konnte es ihm ansehen.
„Allein mag ich auch nicht!“
„Es ist besser, Du bleibst. Bei der Kälte und dem Schnee könnte Dir leicht etwas passieren, wir sind nicht mehr jung!“
„Freilich nicht. Und wenn er nicht bald kommt - “
Vater Hanjost war an das Fenster getreten und schaute hinaus auf den glitzernden Schnee.
„Wie lange wartest Du nun schon,“ sprach er leise, wie zu sich selbst, von dorther. „Den Sommer durch, den Herbst und nun ist der Winter da - -“
„Und Du hast nicht gewartet? - - “
„Wohl, - das habe ich – aber bald warte ich nicht mehr!“
„Lies uns die Weihnachtsgeschichte, Vater!“
„Wohl!“ Er holte die Brille aus der Schublade. Da hob Frau Annemarie die Hand.
„Pst! Da kommt wer. Hörst Du nicht?“
„Ja, doch, der Briefbote vielleicht.“
„Der ist’s nicht!“
Draußen trat jemand fest mit den Fußspitzen vor die Steine der Treppe, der Schnee von den Füßen zu fegen.
„Das ist wirklich der Briefbote nicht,“ sagte Hanjost. Seine Stimme zitterte merklich.
„Mach die Tür auf, Mann!“
Hanjost kam nicht dazu. Schon wurde die Tür aufgerissen von einem, der von draußen kam und der mehr Bescheid wußte in dem altersschwachen, strohgedeckten Häuschen, als Mr. John aus Warburg an der Diemel.
In der Tür stand ein großer, starker Mann, der die Arme ausstreckte mit den Worten:
„Vater! Mutter!“
„Johannes, unser Johannes!“
Dann war es still in dem Stübchen.
Drunten im Dorfe aber läuteten die Glocken zur Christmette.